Alice in Borderland (Staffel 1)
Wieder einmal zeigt sich: Mit der richtigen Adaption auf der richtigen Plattform kann ein Original plötzlich alt aussehen. Das perfekte Beispiel dafür ist Alice in Borderland: Der Manga erschien zwischen 2010 und 2016. Eine deutsche Veröffentlichung war bislang nicht drin und es wurde auch nur eine dreiteilige Anime-Serie produziert, was angesichts der Anzahl von 18 Bänden beinahe als Frevel zu verbuchen ist. Demzufolge hatte der von Shinsuke Sato (Bleach) inszenierte Survival-Titel nahezu keine Chance, im Westen Fuß zu fassen oder gar Popularität zu entwickeln. Netflix änderte dies im Dezember 2020, als die erste Staffel der Live-Action-Serie mit acht Folgen auf dem Streamingdienst online ging. Anders als bei den meisten Serien aus Asien zeigte sich der Streaming-Riese spendierfreudig und investierte in eine deutsche Synchronisation. Mit durchschlagendem Erfolg: Schnell in der Netflix-Top 10 angelangt, brach ein kleiner Hype um die Serie aus. Für Manga-Leser, so möchte man meinen, nichts Neues. Doch die Streaming-Zuschauer waren so aus dem Häuschen, dass kurz darauf angesichts der hohen Abrufzahlen eine zweite Staffel angekündigt wurde. Was ist dran an dem Hype um Alice in Borderland? Und wer ist eigentlich diese Alice?
   |
Der Gamer Arisu Ryouhei (Kento Yamazaki, Death Note) geht auf die Oberschule und ist von seinem Alltag ziemlich gelangweilt. Eines Nachts trifft er sich mit seinen Freunden, dem Barkeeper Karube (Keita Machida, GTO) und dem Büroangestellten Chouta (Yuki Morinaga, Chihayafuru), in der Stadt. Als sie an einer belebten Kreuzung in Shibuya Schabernack treiben, ist bald die Polizei hinter ihnen her, sodass sich die Jungen kurzerhand in der Klokabine einer Bar verstecken. Dann legt ein Stromausfall alles lahm und als sie auf die Straßen Tokios zurückkommen, müssen sie feststellen, dass außer ihnen alle Menschen verschwunden sind und sie sich augenscheinlich in einer anderen Welt befinden, die allerdings exakt wie die ihnen bekannte aussieht. Sie werden daraufhin mittels Benachrichtigungen auf ihren Smartphones gezwungen, an tödlichen Survival Games teilzunehmen. Eine Verweigerung dessen kostet das eigene Leben und um den Weg zurück in ihre Welt zu finden, müssen sie nun mitspielen. Bald darauf finden sie sich in einem Gebäude weder, in dem jeder Raum zwei Türen hat: Eine Türe mit „Leben“ und eine mit „Tod“. Jeder falsche Versuch beim Lösen dieses Rätsels führt zum sofortigen Abbruch des Spiels und damit zum sofortigen Ableben …
Alice? Who the F*ck is Alice?
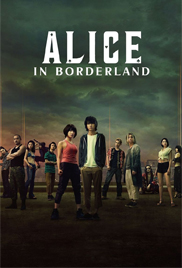 |
|
| Originaltitel | Alice in Borderland |
| Jahr | 2020 |
| Land | Japan |
| Episoden | 8 in Staffel 1 |
| Genre | Survival-Thriller, Action |
| Cast | Arisu Ryohei: Kento Yamazaki Yuzuha Usagi: Tao Tsuchiya Shuntaro Chishiya: Nijiro Murakami Chota Segawa: Yuki Morinaga Daikichi Karube: Keita Machida Shibuki Saori: Ayame Misaki Rizuna An: Ayaka Miyoshi Niragi: Dori Sakurada |
| Veröffentlichung: 10. Dezember 2020 auf Netflix | |
Der Platz 2-Hit der Band Gompie aus dem Jahr 19986 ist hier Programm: Wer ist diese Alice, die wir nie kennenlernen dürfen? Die Frage ist einfach zu beantworten: „Arisu“ ist die romanische Schreibweise von Alice. In der japanischen Aussprache ist das U beinahe stumm und wird verschluckt, sodass der Name eigentlich „Aris“ (mit Zischel-S) ausgesprochen werden müsste. Ein Patzer, der einer erfahrenen Synchronregie eigentlich hätte auffallen müssen – zumindest können Anime-Zuschauer ein Lied davon singen, wie über Jahre hinweg Namen in deutschen Synchronisationen falsch ausgesprochen werden. Dass das Borderland („Grenzgebiet“) als Kontrast zum Wunderland aus Alice im Wunderland steht, erklärt sich dann von selbst, womit auch die Bedeutung des Titels geklärt ist.
Netflix sollte wohl häufiger über Synchronisationen nachdenken
Inhaltlich deckt die Netflix-Serie 31 Kapitel der Manga-Reihe ab, 33 blieben bislang unberührt – damit ist auch schon eine grobe Richtung gegeben, dass eine zweite Staffel erneut in acht Episoden erzählt werden könnte. Doch Stoff existiert noch genug, denn vier Jahre nachdem der Manga beendet wurde, startete Autor und Zeichner Haro Aso passenderweise im Oktober 2020 eine Fortsetzung. Alice in Borderland Retry führt die Geschichte fort, die inhaltlich sowieso darauf ausgelegt ist, bis zur Unendlichkeit erzählt zu werden. Demzufolge könnte man die Kuh melken, solange Interesse besteht. Netflix sollte es jedenfalls zu denken geben, dass eine Synchronisation Barrieren auflösen und auch langfristig Zuschauender binden kann.
Death Games – ein alter Hut in Japan
In Japan sind Death Games und Survival-Serien wie Sand am Meer zu finden: Ob in Videogames (Danganronpa), Film (Battle Royale) oder im Anime- und Manga-Bereich (GANTZ, King’s Game, Mirai Nikki oder Doubt): Die Begeisterung für tödliche Szenarien ist riesengroß. Da bildet Alice in Borderland in der Tat nur den Tropfen auf dem heißen Stein. Im Westen ist diese Vorliebe etwas weniger ausgeprägt und zumeist eher im Horror- als im Thriller-Genre zu finden. Populäre Vertreter sind die Saw-Reihe, die Cube-Trilogie oder einzelne Filme wie Escape Room. Alice in Borderland fokussiert sich im Gegensatz zu den meisten auf kein festes Szenario, sondern wechselt dieses in der Regel nach zwei Folgen aus. Das bedeutet, dass die Spieler dann wieder einer neuen Gefahr, einem neuen Rätsel und neuen Gefährten ausgesetzt sind. Am ehesten vergleichen lässt sich die Serie deshalb mit dem Multimedia-Crossover GANTZ, das hierzulande als Anime-Serie (Nipponart), Manga (Manga Cult) und Live Action-Filmen (SUNFILM Entertainment) erschien. Und passenderweise führte Alice in Borderland-Regisseur Shinsuke Sato bei letzteren auch Regie. Der Kreis schließt sich …
Kartenspielen mal anders
Was sofort ins Auge sticht, sind die hohen Produktionswerte: Vor allem für eine japanische Live Action-Serie (die oftmals mit geringen Mitteln auskommen muss) sticht Alice in Borderland regelrecht ins Auge. Das Kartenspiel, das den Dreh- und Angelpunkt der Handlung bildet, ist schnell erklärt, nicht zu komplex aufgezogen und stellt den passenden Aufhänger dar, um sofort im Geschehen zu sein. Das kommt der Handlung zu Gute, denn kaum dass man wegzappen könnte, ist man bereits angefixt. Die eigentlichen Stars sind aber nicht etwa die Darsteller, sondern die tödlichen Spiele. Bei jedem Spiel geht es um eine Spielkarte. Deren Farbe (Kreuz, Pik, Herz oder Karo) entscheidet über die Grundart der Herausforderung. Pik-Karten erfordern eine hohe physische Stärke oder Kondition, bei Karo ist Intelligenz gefragt, Kreuz-Karten verlangen Teamwork und Herzen … treffen mitten ins Herz, denn dabei handelt es sich um Spiele, bei denen emotional manipuliert werden muss. Der Zahlenwert soll den Schwierigkeitsgrad ausmachen. Das ergibt nicht immer Sinn, denn gerade zu Beginn wird einer Dreier-Karte gezogen, doch die Auflösung des tödlichen Rätsels ist so schwierig, dass die Gruppe nur mit viel Glück (genauer gesagt: durch Arisus Scharfsinnigkeit) weiterkommt. Bis ins Detail wirkt das nicht durchdacht und die Handlung lebt auch davon, dass viele Situationen gerade nur so vor Ablauf eines Countdowns aufgelöst werden. Mit der Zeit durchschaut man solche Szenen relativ schnell.
Herkunft: unverkennbar
Worin man der Serie ihre Manga-Herkunft immer wieder anmerkt, sind die teilweise langen Dialoge innerhalb von Kampfszenen, die dadurch immer wieder ausgebremst werden. Da können sich zwei Figuren auch mal eine Folge lang gegenüberstehen und während des Getümmels reden (Folge 7), dann folgt erst noch ein Rückblick in die Vergangenheit hier, eine Erklärung für ein bestimmtes Verhalten dort. Und auch die emotionalen Ausbrüche der Figuren erinnern ohnehin an Manga-Charaktere, denn sie stellen in der Regel immer ein Extrem dar. Das mag bisweilen für Zuschauer*innen, die wenig mit Anime und Manga am Hut haben, befremdlich wirken. Aber Alice in Borderland legt weder Wert auf Realismus, noch auf Logik. Logik wird immer wieder vernachlässigt, was sich dann auch in vielen Szenen wiederspiegelt. Etwa im letzten Spiel, in dem 58 Personen involviert sind. Selbst nachdem zahlreiche Figuren bereits tot sind, laufen dort noch immer viel zu viele Personen herum, sodass diese 58 – auch ohne große Zählung – längst überschritten ist. Die Serie leistet sich immer wieder einen Fauxpas dieser Art, was angesichts des mitunter hohen Unterhaltungswerts verzeihbar ist, manchem Zuschauer aber auch sauer aufstoßen kann.
Dramaturgisch wird nicht aus den Vollen geschöpft
Auch Optimierungspotenzial birgt die Dramaturgie innerhalb der Staffel: Folge 3 bietet die wohl größte Dramatik des Handlungsverlaufs an. Hierin müssen die drei Freunde Arisu, Karube und Chota sowie ihre Begleiterin in einem besonders hinterlistigen Versteckspiel gegeneinander antreten, bei dem am Ende nur eine*r von ihnen am Leben bleiben soll. Das fühlt sich wie ein verfrühtes Staffelende an, denn persönlicher als in diesem Kreis wird es zum Ende hin nicht mehr. Dennoch fiel die Entscheidung dafür, im letzten Spiel der ersten Staffel vor allem auf Panik und Hysterie zu setzen, denn dabei handelt es sich um jene Episoden mit dem meisten Adrenalin. Aber wozu dies nun alles? Zumindest aus Zuschauerperspektive lassen sich kritische Töne identifizieren: Alice in Borderland kritisiert eine Gesellschaft, in der Charaktereigenschaften wie Loyalität und Selbstlosigkeit als Tugenden zelebriert werden und Individualismus, das Streben nach Selbstverwirklichung und geistige Gesundheit nichts gelten. Nicht selten übertreibt die Serie es allerdings mit ihren Weisheiten, wie sich beispielsweise an der Figur des Hatters (noch eine Anspielung auf Alice im Wunderland) zeigt. Beispiel gefällig? „Sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst“ und andere Weisheiten werden herauf und herunterzitiert. Die Serie hat es dabei gar nicht notwendig, auf Teufel-komm-raus tiefgründig sein zu müssen.
Fazit
 Alice in Borderland ist eine dynamische High-Concept-Serie, der man einen gewissen Suchtfaktor nicht absprechen kann. Die Serie überzeugt mit ihren Produktionswerten und ihrem Look, so dass es eine Freude macht, dem Treiben einfach nur zuzusehen. Erzählerisch bleibt Luft nach oben: Die Bedeutung der einzelnen Karten wirkt mitunter willkürlich und manchmal bleibt unklar, weshalb ein Spiel, das man selbst als höchst schwierig einschätzen sollte, nun dem Schwierigkeitsgrad einer 3 entspricht. Hier passt das Drehbuch gerne die Regeln an, wie es gerade am besten passt. Wer sich nicht an japanischem Overacting stört und sich auch auf schablonenhafte Charaktere, wie man sie aus Mangas kennt, einlassen kann, wird mit Alice in Borderland eine gute Zeit haben können. Die Aussicht auf eine zweite Staffel (oder vielleicht noch viel mehr) ist jedenfalls vielversprechend und vielleicht kann Netflix damit nun auch eine langfristige Hit-Serie etablieren. Vor allem aber für Produktionen aus Asien zeigt sich, dass es sich lohnen kann, den Zugang für eine breite Masse zu legen und mittels Synchro zu erleichtern.
Alice in Borderland ist eine dynamische High-Concept-Serie, der man einen gewissen Suchtfaktor nicht absprechen kann. Die Serie überzeugt mit ihren Produktionswerten und ihrem Look, so dass es eine Freude macht, dem Treiben einfach nur zuzusehen. Erzählerisch bleibt Luft nach oben: Die Bedeutung der einzelnen Karten wirkt mitunter willkürlich und manchmal bleibt unklar, weshalb ein Spiel, das man selbst als höchst schwierig einschätzen sollte, nun dem Schwierigkeitsgrad einer 3 entspricht. Hier passt das Drehbuch gerne die Regeln an, wie es gerade am besten passt. Wer sich nicht an japanischem Overacting stört und sich auch auf schablonenhafte Charaktere, wie man sie aus Mangas kennt, einlassen kann, wird mit Alice in Borderland eine gute Zeit haben können. Die Aussicht auf eine zweite Staffel (oder vielleicht noch viel mehr) ist jedenfalls vielversprechend und vielleicht kann Netflix damit nun auch eine langfristige Hit-Serie etablieren. Vor allem aber für Produktionen aus Asien zeigt sich, dass es sich lohnen kann, den Zugang für eine breite Masse zu legen und mittels Synchro zu erleichtern.
© Netflix







